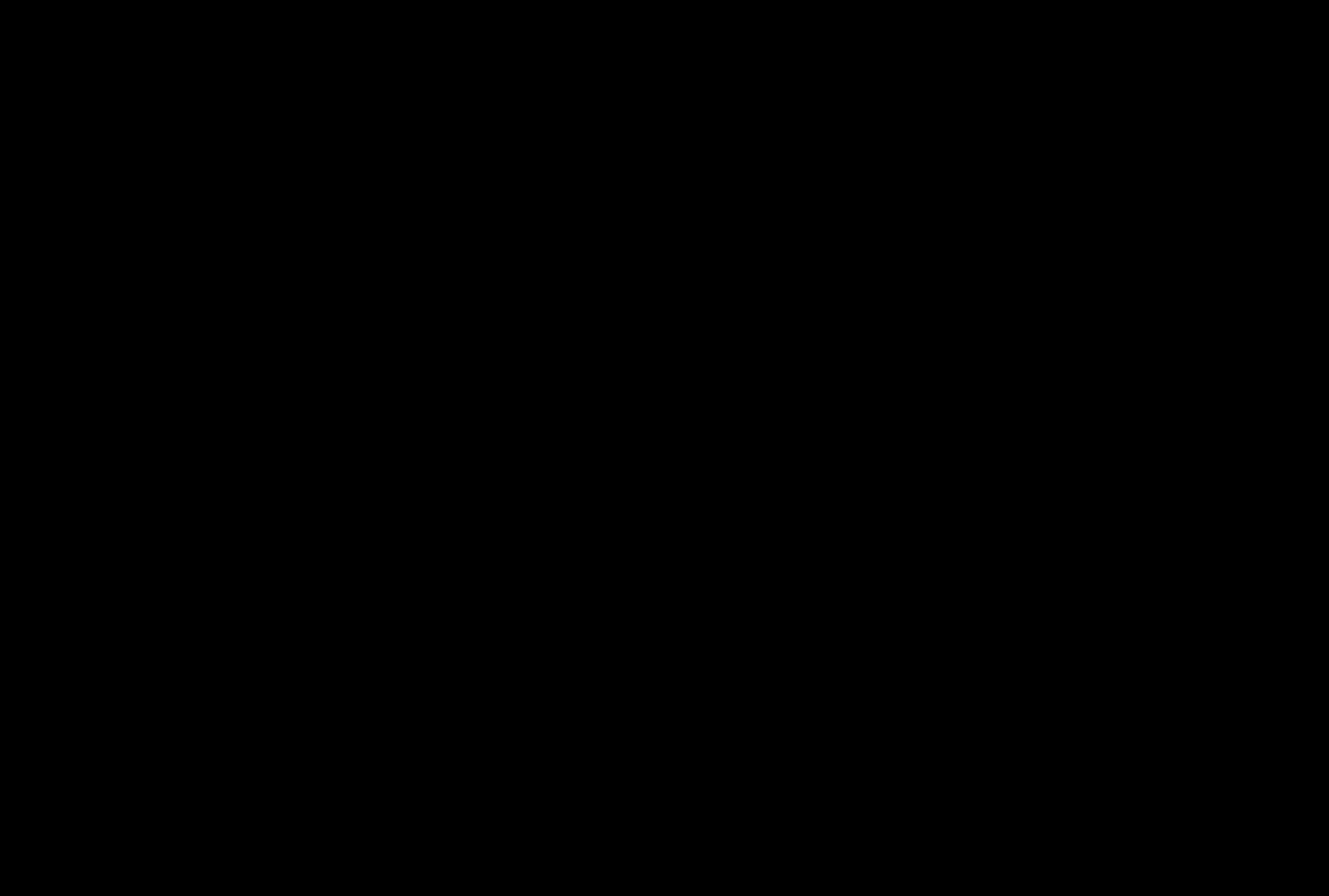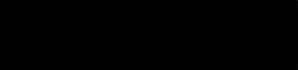Klimapolitik: Aktuelles in Kürze
Hier thematisieren wir regelmässig aktuelle energie- und klimapolitische Herausforderungen und unsere Vorschläge für Energiezukunft und Dekarbonisierung. Kompakt, verständlich und mit unseren wichtigsten Forderungen an die nationale Politik.
Verwandte Themen:
Klima & EnergieÜbersicht
- Februar 2026: Investitionslücke beim Klimaschutz
- November 2025: Sieben Instrumente für einen zukunftsfähigen Gebäudepark
- Mai 2025: Sparen beim Klimaschutz - heute günstig, morgen teuer
- März 2025: Zukunftsfähige Spielregeln für den Schweizer Finanzplatz
- August 2024: WWF-Rating: die Energiepolitik der Kantone im Vergleich
- Juli 2024: Klimaschutz: Gesetzlichen Handlungsspielraum nutzen
- März 2024: CO2-Ablasshandel der Schweiz: klimapolitischer Holzweg mit Ansage.
- Ältere Beiträge
Klimaschutz hat seinen Preis. Rund zwei Milliarden pro Jahr investiert der Bund in nationale Fördermittel in diesem Bereich, wobei diese Gelder grösstenteils verursachergerecht über Abgaben erhoben werden und keine allgemeinen Bundesmittel sind. Nüchtern betrachtet stellen sich dabei zwei Fragen:
• Reicht diese Summe, um das Ziel Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen?
• Welcher Nutzen wird mit diesen Investitionen erzielt?
Unsere Antworten: Die zwei Milliarden reichen bei Weitem nicht aus, und der Nutzen ist immens. Entsprechend diagnostiziert der WWF eine Investitionslücke beim Klimaschutz.
Zusammengefasst liefert unsere Analyse fünf zentrale Erkenntnisse:
- Die für die Dekarbonisierung nötigen privaten und öffentlichen Investitionen sind hoch. Im Vergleich zu den jährlichen Anlageinvestitionen in der Schweiz bleiben sie jedoch tief und sind finanzierbar.
- Investitionen in die Dekarbonisierung machen uns unabhängiger von fossilen Energien. Dadurch fallen laufend Ausgaben weg, und die Investitionen zahlen sich weitgehend selbst zurück.
- Investitionen in den Klimaschutz reduzieren Schadenskosten: Weniger Emissionen reduzieren Klimaschäden in der Schweiz und weltweit und damit die Belastung für Staaten, Wirtschaft und Haushalte.
- Tempo zahlt sich aus: Je schneller in den Klimaschutz investiert wird, desto tiefer sind die Kosten des Klimawandels und der Energieimporte. Förder- und Lenkungsinstrumente sowie Minimalanforde-rungen sollten deshalb zeitnah ausgebaut werden.
- Das Auslösen der nötigen Klimaschutzinvestitionen verhilft Innovationen zum Durchbruch. So ent-stehen lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
Der auf Energieeffizienz und Klimaschutz ausgerichtete Umbau des Gebäudeparks ist eine Erfolgsgeschichte. Aktuell gefährden aber gleich zwei Entwicklungen die Energiewende im Gebäudebereich. Zum einen der Wegfall der Steuerabzüge für energetische Sanierungen und erneuerbare Energien zum Beispiel von Solaranlagen (Eigenmietwert-Abstimmung vom 28. September 2025). Zum anderen die geplanten Kürzungen beim Gebäudeprogramm (Entlastungspaket 27). Der Vorschlag der ständerätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK-S) vom 31.10.2025 wird dieser Ausgangslage nicht gerecht und würde einen starken Abbau im Klimaschutz bedeuten.
Wie gelingt es, dass unsere Häuser trotzdem zukunftsfähig umgebaut werden? Hauseigentümer müssen weiterhin dazu motiviert werden, Gebäudehüllen energetisch zu verbessern, CO2-frei zu heizen und Solaranlagen auf
Dach und Fassade zu montieren.
Der WWF-Ansatz ist ein fein austarierter Mix, der die richtigen Anreize setzt und dabei sozialverträglich und effizient bleibt. Konkret hält der WWF eine Kombination aus den folgenden sieben Instrumenten für geeignet, den Gebäudepark zukunftsfähig zu machen.
- Weiterführung Gebäudeprogramm mit erhöhten Fördersätzen
- Erhöhung der CO2-Abgabe
- Sichtbare Teilrückverteilung der CO2-Abgabe
- Vermieterinnen und Vermieter ungedämmter Gebäude beteiligen sich an CO2-Abgabe
- MuKEn 2025 Module zu Heizungsersatz und Sanierung als Mindeststandards
- Finanzielle Attraktivität von Solaranlagen erhöhen
- Bonus-Malus-System als Anreiz zur sparsamen Nutzung von Wohnrau
Am 5. Mai endete die Vernehmlassung des Bundes zum Entlastungspaket 27. Jetzt soll es schnell gehen: Laut Fahrplan des Bundesrats soll das Kürzungspaket bereits per Anfang 2027 in Kraft treten. Rund ein Viertel des gesamten Kürzungsvolumens betrifft den Umweltbereich und insbesondere den Klimaschutz. Doch genau beim Klimaschutz kommen vermeintliche Einsparungen mittelfristig teuer zu stehen. Gleichzeitig hält der Bund an umweltschädigenden Subventionen fest und verzichtet damit auf grosse Einsparungen mit doppeltem Nutzen für die Bundeskassen.
Das Wichtigste im Überblick:
- Mit mehr als 1 Milliarde von total 3.6 Mrd. Franken jährlich (ab 2028) ist der Umweltschutz überproportional von den Kürzungsmassnahmen betroffen. Besonders einschneidend sind die Streichung der Bundesgelder für das Gebäudeprogramm (389 Mio./Jahr) sowie diverse Kürzungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs (260 Mio./Jahr).
- Die vermeintlichen Entlastungsmassnahmen beim Klimaschutz belasten den Bundeshaushalt mittelfristig zusätzlich. Wer jetzt notwendige Investitionen aufschiebt, verursacht höhere Kosten für kommende Generationen.
- Der Bund subventioniert nach wie vor umweltschädliche Aktivitäten in Milliardenhöhe. Das Entlastungspaket versäumt es weitgehend, diese Fehlanreize abzubauen, dabei wäre das eine doppelte Entlastung für die Bundesfinanzen.
- Es braucht dringend Korrekturen, um die Finanz- und Klimapolitik auf Zukunftskurs zu bringen. Der WWF-Lösungsansatz: Eine fundierte Folgeabschätzung der Kosten der Kürzungen, die budgetneutrale Weiterführung des Gebäudeprogramms und ein Abbau von klimaschädlichen Subventionen.
Seit einiger Zeit und besonders seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump treten nordamerikanische Finanzinstitute reihenweise aus internationalen Netto-Null-Allianzen wieder aus.
Der Trend steht sinnbildlich für den verstärkten Gegenwind, dem der Klima- und Umweltschutz und damit auch nachhaltige Finanzen in den USA aktuell ausgesetzt sind.
Damit wird eine Negativspirale in Gang gesetzt, an deren Ende möglicherweise auch Finanzinstitute in anderen Weltregionen ihr Klima-Engagement überdenken oder gar zurückfahren. Das zeigt schonungslos die Grenzen von freiwilligen Netto-Null-Allianzen: Ohne effektive Korrektur- und Sanktionsmöglichkeiten hängt die Wirksamkeit solcher Zusammenschlüsse letztlich vom Goodwill ihrer Mitglieder ab.
Die Grenzen von Freiwilligkeit und Selbstregulierung in der Finanzbranche sind es auch, die mitentscheidend waren für den Startschuss zur Volksinitiative für einen nachhaltigen und zukunftsgerichteten Finanzplatz Schweiz. Die Initiative verlangt verbindliche rechtliche Rahmenbedingungen für Geschäfte von Schweizer Finanzinstituten im Ausland, damit diese mehr Verantwortung für Natur und Klima übernehmen. Sie wird von einer Breiten Allianz getragen und hat das Potenzial, die Sustainable Finance-Politik der Schweiz in den nächsten Jahren tiefgreifend zu verändern.
Mit einem Anteil von 40 Prozent am Energieverbrauch und rund einem Viertel der Schweizer Treibhausgasemissionen spielt der Gebäudesektor eine zentrale Rolle bei der Energiewende und der Bekämpfung des Klimawandels. Zuständig für diesen entscheidenden Hebel: Die Kantone. Ohne sie kann die Schweiz ihre Klimaziele nicht erreichen. Doch wo stehen die 26 Kantone bei ihrer Energie- und Klimapolitik?
In Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen EBP und mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz hat der WWF die Bemühungen um eine klimabewusstere Regelung des Gebäudesektors umfassend analysiert und verglichen. Die wichtigsten Ergebnisse des Kantonsratings 2024 im Überblick:
- Der klimafreundlichste Kanton der Schweiz ist erneut Basel-Stadt, gefolgt von Neuenburg und Uri. Am meisten aufzuholen hat Appenzell Innerhoden.
- Insgesamt konnten im Vergleich zum Rating 2019 erhebliche Fortschritte erzielt werden. Trotzdem verfügt noch kein Kanton über eine Klima- und Energiepolitik, die mit der Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5°C im Einklang steht.
- Vor allem beim Austausch alter Heizungen durch klimafreundlichere Alternativen hat sich viel getan. Der grösste Handlungsbedarf herrscht hingegen bei der Sanierung von Gebäuden und der Umstellung auf E-Mobilität.
- Eingesetzte Massnahmen zeigen oft erst nach jahrelanger Verzögerung Wirkung. Die aktuelle Überarbeitung der sogenannten Mustervorschriften im Energiebereich sollte deshalb möglichst griffig erfolgen, die Vorschläge sollten durch die Kantone möglichst zeitnah umgesetzt werden.
Seit dem Klima-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) wird in der Schweiz ebenso leidenschaftlich wie kontrovers über dessen Folgen diskutiert. Unabhängig von der rechtlichen Einordnung ist Fakt: Mit der aktuellen Politik ist die Schweiz weit davon entfernt, die eigenen sowie die internationalen Klimaziele zu erreichen. Fakt ist auch: Im politischen System der Schweiz hat das Volk das letzte Wort, entsprechend begrenzt ist der Handlungsspielraum der Politik. Doch ist dieser Spielraum hinsichtlich Klimaschutz tatsächlich bereits ausgereizt, wie häufig zu hören ist? Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben uns einige Gesetz und deren Umsetzung genauer angesehen und dabei zahlreiche, durch das Volk oder Parlament legitimierte Möglichkeiten ausgemacht, wie in Sachen Klimaschutz nicht nur nachgebessert werden kann, sondern aufgrund der klaffenden Klimaschutz-Lücke auch muss:
- Klimaschutzgesetz: Der Bund lässt die Möglichkeit, die Finanzbranche stärker auf Klima- und Umweltschutz auszurichten, praktisch ungenutzt. Dabei ist die Umlenkung der nationalen und internationalen Geldflüsse der wichtigste Klimaschutz-Hebel der Schweiz. Auch fehlt bislang die Umsetzung der Vorbildrolle von Bund und Kantonen, wie sie im Gesetz zwingend vorgesehen ist.
- CO2-Gesetz: Da diese Gesetzesrevision stark auf Förderung durch zweckgebundene Abgaben mit ohnehin beschränkter Wirksamkeit setzt, sollten diese nun zumindest entlang der gesetzlichen Maximalbeträge ausgerichtet werden. Zielvereinbarungen mit Unternehmen und den Treibstoffimporteuren sollten den gesetzlichen Spielraum nach oben nutzen.
- Stromgesetz: Das Gesetz ist ein Meilenstein für die Energiewende. In den Verordnungsentwürfen zur Umsetzung besteht aber noch viel Luft nach oben. So könnte die Planungssicherheit, etwa für den Bau von Solaranlagen auf Gebäuden, deutlich verbessert werden. Die Vorbildrolle des Bundes in den Bereichen Solar und Effizienz wird im Verordnungsentwurf nicht umgesetzt.
- Umweltschutzgesetz: Insbesondere im Bauwesen kann der Bundesrat nun Bestimmungen einführen, welche den Fussabdruck des Neu- und Umbaus massiv reduzieren. Die neuen Bestimmungen zur Kreislaufwirtschaft erlauben es, hier die fortschrittlichen Bestimmungen der EU harmonisiert zu übernehmen.
Zahlreiche Gesetze haben direkten oder indirekten Einfluss auf den Klimaschutz und die Energiezukunft der Schweiz. Die vier genannten stellen nur eine kleine Auswahl dar, haben aber gemeinsam, dass sie alle am 1. Januar 2025 oder im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten und derzeit durch das Ausarbeiten der sogenannten Verordnungen präzisiert werden. Diese Aufgabe obliegt dem Bundesrat und den Kantonsregierungen, die damit eine wichtige Rolle einnehmen. Denn in den Verordnungen werden die zahlreichen offenen Zielvorgaben der Gesetze näher ausgeführt, wodurch bestimmt wird, wie wirksam ein Gesetz tatsächlich umgesetzt wird.
Noch in dieser Frühlingssession wird das CO2-Gesetz vom Parlament finalisiert. Dabei setzt man in Bern nach wie vor auf den Kauf von Auslandszertifikaten und damit auf Kompensationsprojekte, statt auf die Reduktion der eigenen Emissionen. Mit diesem Ablasshandel steht die Schweiz weltweit ziemlich isoliert da. Kein anderes Industrieland verfolgt das Modell in vergleichbarem Ausmass. Schliesslich ist das Vorgehen nicht nur äusserst umstritten. Es entpuppt sich immer deutlicher als Holzweg und schwächt den globalen Klimaschutz.
Das Wichtigste im Überblick:
- Durch den jahrelangen Ablasshandel hat die Schweiz zu wenig eigene Emissionen reduziert und einen CO2-Schuldenberg angehäuft, der weiterwächst.
- Laut Studien erreicht höchstens ein Viertel der verkauften Zertifikate auch tatsächlich die ausgewiesene Reduktion. Die Schweiz belastet das Klima also erheblich stärker als behauptet wird.
- Klimafreundliche Technologien verzeichnen weltweit ein rasantes Wachstum. Doch ohne konsequente Reduktionspläne im Inland fehlt es in der Schweiz an Markt-Anreizen. Die heimische Wirtschaft wird abgehängt.
- Zielkonflikte in Partnerländern lassen geeignete Projekte zur Mangelware werden. Nur ein Viertel der von 2021 bis 2030 nötigen Kompensation konnte bisher vertraglich gesichert werden.
- WWF-Lösungsvorschlag: Mit drei Massnahmen zu einer zukunftsfähigen Klimapolitik.
Auf dem globalen Parkett gilt die Europäische Union häufig als Vorreiterin, wenn es um Klimapolitik geht. Tatsächlich hat die Staatengemeinschaft mit ihrem Green Deal 2019 einen ebenso ambitionierten wie integrativen Weg eingeschlagen, der sämtliche Bereiche umfasst und den Boden bereiten soll für eine klima- und umweltgerechte Marktwirtschaft der Zukunft. Seither wurden bereits zahlreiche konkrete Gesetzesanpassungen verabschiedet, wobei in Brüssel 27 teils sehr unterschiedliche Staaten unter einen Hut gebracht werden müssen. Was sind wichtige Massnahmen und was davon könnte auch für die Schweiz sinnvoll sein?
Das Wichtigste im Überblick:
- Bis 2050 will die EU klimaneutral werden, bis 2030 sollen die Emissionen gegenüber 1990 um 55 Prozent sinken.
- Auf Auslandskompensation wird dabei verzichtet. Das Reduktionsziel ist damit erheblich ambitionierter als das der Schweiz.
- Der Emissionshandel für grosse CO2-Emittenten, den die Schweiz bislang 1:1 übernahm, wird verschärft und ausgeweitet.
- Gratis-Verschmutzungsrechte zum Schutz der energieintensiven Industrie vor ausländischer Konkurrenz werden schrittweise durch einen neuen CO2-Grenzausgleich ersetzt. Die Schweiz sollte hier mitziehen.
- Nicht alle Ansätze der EU sind zu begrüssen. Die Beimischpflicht von Biotreibstoffen im Verkehrssektor schadet letztlich der Umwelt. Nur synthetische Treibstoffe aus erneuerbaren Quellen sollten beigemischt werden.
Mit den schon getroffenen und anstehenden Entscheidungen im Mantelerlass gestalten wir unsere Energie-Zukunft. Doch wie wirken sich diese Entscheidungen konkret aus? Diese Zahlen haben wir für Sie zusammengestellt. Unsere Abschätzungen zeigen:
- prinzipiell sind die Vorschläge des Parlaments geeignet, eine sichere Stromversorgung bis 2030 zu garantieren;
- Solarstandard auf Gebäuden und Parklätzen, die Verbesserung der Vergütung von produziertem erneuerbarem Strom und die Einführung eines Effizienzdienstleistungsmarktes sind von entscheidender Bedeutung;
- materielles Umweltrecht beim Gewässer- und Naturschutz abzubauen, liefert hingegen keinen relevanten Beitrag und ist mit Blick auf die Biodiversitätskrise abzulehnen;
- und es wird weitere Gesetzesrevisionen brauchen.
Sind wir in Sachen Energiewende auf Kurs?
Auch wenn der Bundesrat vor drei Jahren die Gesamtwirkung seines damaligen Vorschlags zum Mantelerlass abgeschätzt hat, fehlt bis heute eine Analyse, welche der nun vom Parlament gewählten Instrumente und Bestimmungen wieviel dazu beitragen und weshalb. Man weiss auch nicht, was die seither erfolgte Revision durch die parlamentarische Initiative Girod und die bisher von National- und Ständerat angenommenen Gesetzesänderungen konkret für eine sichere Energieversorgung bringen. Im Unterschied zur EU publiziert die Verwaltung solche detaillierten Wirkungsabschätzungen nicht. Das liegt (auch) an den Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Vor allem die Kombination der Instrumente hat Auswirkungen, denn je nachdem wie man direkte Förderung, steuerliche Anreize, Gebote und Verbote kombiniert, verändert sich auch die Wirkung. Trotzdem versuchen wir an dieser Stelle eine grobe Abschätzung für das Jahr 2030 – unter folgenden Annahmen:
- Beznau ist nicht mehr am Netz
- die EU beschränkt die Importkapazität der Schweiz tatsächlich einseitig
- es geht im Moment nur um die Stromversorgungssicherheit
- der Ausstieg aus fossilen Energien schreitet rascher voran als bisher
- Lieferkettenprobleme und Fachkräftemangel führen weiterhin zu Verzögerungen, aber das Investitionswachstum bleibt
- die fossilen Höchstpreise von 2022 werden nicht mehr erreicht
- die Gaspreise gehen nicht so weit zurück, dass ein niedriger Strommarktpreis Investitionen ausbremst.
Im Sommer werden wir auch weiterhin kein Stromversorgungsproblem haben.1 Wir konzentrieren uns deshalb auf die Winterversorgung. Pikantes Detail: In Europa wurde bisher im Winter mehr erneuerbarer Strom als im Sommer produziert. Ohne Importrestriktionen wären also die Energiewendeprioritäten womöglich anders zu setzen.
Winterstromversorgung Schweiz 2030
Vor allem Elektromobilität und Wärmepumpen werden dazu führen, dass bis 2030 mehr Strom verbraucht werden wird. Dieser Anstieg wird kaum kompensiert werden können, da bestehende und
neue Stromeffizienz-Instrumente im Mantelerlass, im Klimaschutzgesetz (KlG) und in den kantonalen Energiegesetzen schwach ausgestaltet sind. (Detailierte Angaben zum Verbrauch im Winter 2023 im PDF).
Auf der Produktionsseite gibt es gewollte Einbussen, weil AKW schrittweise ausser Betrieb gesetzt werden und bei Neukonzessionierungen minimale Restwassermengen eingehalten werden. Die Sistierung des Gewässerschutzgesetzes gemäss NR hätte auf die Energieversorgung kaum einen Einfluss, weil die vorgeschriebenen Restwassermengen ohnehin tief sind und nur relativ wenig Neukonzessionierungen bis 2035 erwartet werden. Generell sieht man, dass diese Debatte ideologisch geprägt ist - für die sichere Energieversorgung ist sie irrelevant.
Die folgende Tabelle zeigt die weiteren Beiträge verschiedener Gesetze beziehungsweise Instrumente im Mantelerlass. Es zeigt sich, dass die noch umstrittene Ausgestaltung des Solarstandards auf Gebäuden und Parkplätzen einen grossen Einfluss auf die verfügbaren Solarflächen und deren Ertrag hat und somit die grösste politische Aufmerksamkeit verdient.
- Produktion Winter 2030 in TWh Nettoerzeugung 2020/2021 31.8 Wegfall Beznau I+II -3.5
- Einhaltung gesetzliche Restwasserbestimmungen bei Neukonzessionierung -0.1
- Sistierung Restwasserbestimmungen gemäss NR (Eng Art 2a). Periode 2025-2030. +0.05
- Verbesserte und verlängerte Förderbedingungen PaIV Girod (in Kraft) +2.3
- Solaralpin-Express (in Kraft) (Annahme: 45% Winteranteil von maximal 2 TWh) +0.9
- Wind-Express (Variante NR) (Obere Grenze von 0.8 TWh (66% von 1.2 TWh) ist unsicher, da viele Projekte noch in früher Planungs- und Bewilligungsphase) +0.4
- Verbesserte Bedingungen Rückspeisevergütung plus gleitende Marktprämie plus Anpassung Raumplanungsgesetz innerhalb Mantelerlass +1
- Solarstandard auf Parkplätzen, neuen Gebäuden und bei Dachsanierungen (Range entspricht Gestaltungsspielraum des SR-Plenums) +1
- bis 3 15 Runde-Tisch-Wasserkraft-Projekte im Mantelerlass (Annahme: Projekte mit 25% des Potenzials werden bis 2030 umgesetzt) +0.5
- Resultierende Winterstromproduktion 2030 34.35-36.35
- Maximaler Winternettoimport (SR will maximal 5, NR will maximal 6.6) +5
- Maximales Winterstromangebot 39.35-41.35 (eigene grobe Abschätzungen)
Diese Abschätzungen machen deutlich, dass bei guter Ausgestaltung des Mantelerlasses durch das Parlament die Schweiz an Stromversorgungssicherheit gewinnen würde. Die Importkapazität könnte für Sonderfälle, wie Ausfall von AKWs, Dürren oder extrem kalte Winter reserviert werden.
Also alles paletti?
Nicht wirklich. Unsere Berechnungen in der Tabelle zeigen, dass der Abbau am materiellen Umweltrecht keinesfalls für relevante Mengen an zusätzlicher Stromproduktion sorgen würde. Deshalb muss aus unserer Sicht die NR-Version des Mantelerlasses korrigiert werden. Damit der Zubau an Produktionskapazität genügend beschleunigt werden kann, braucht es eine übergeordnete Schutz-Nutzenplanung und effizientere Bewilligungsprozesse. Eine Gesetzesvorlage hierzu ist auf den Sommer angekündigt. Diese muss zwingend auch für den Netzausbau gelten, damit neue Kraftwerke ihren Strom auch wirklich ins Netz einspeisen können. Für ein intelligentes Netz, das Produzenten, Verbraucher und Speicher (inkl. (Auto)-Batterien) als Gesamtsystem optimiert, braucht es weit mehr als intelligente Zähler und sicherlich die Anpassung weiterer Spielregeln.
Schliesslich ist bereits aufgrund der wenig ambitiösen Bundesratsbotschaft klar, dass der Netzzuschlag von 2.3 Rp/kWh für die verdoppelten Zubauziele kaum ausreicht. Für die Zeit ab 2030 sind Anpassungen nötig.
Aus Sicht des WWF ist das in dieser Zusammenstellung angenommene Tempo für den Ausstieg aus fossilen Energien zu langsam. Die Elektrisierung muss schneller vorangetrieben werden. Die solare Nutzung weiterer Gebäude- und Infrastrukturflächen und die noch konsequentere Nutzung der Effizienzpotenziale muss deshalb ebenfalls Gegenstand nächster Revisionen darstellen.
Fazit
«Um gute politische Entscheidungen zu treffen, braucht es Transparenz über die Wirkung der getroffenen Massnahmen. Ganz besonders in einem so umstrittenen Bereich wie der Energieversorgung. Aus diesem Grund teilen wir unsere Einschätzungen und Einordnungen mit Ihnen - mögen sie auch auf einer groben Annäherung beruhen und nur bis 2030 reichen. Weder Panik noch Aussitzen lösen die Herausforderungen: Packen wir sie an!»

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Der andauernde Krieg verursacht ungeheures Leid – und zeigt, wie fragil die Gasversorgung der Schweiz ist. Wie wir aus dieser Falle herauskommen und gleichzeitig grosse Schritte vorwärts beim Klimaschutz machen, skizzieren wir hier. Weitere Hintergrundinformationen dazu gibts im aktuellen Faktenblatt zum Thema Erdgas.
Das Wichtigste in Kürze:
- Erdgas spielt in der Schweiz eine wichtige Rolle – für die Heizung von Gebäuden und die Industrie. Der Erdgas-Verbrauch verharrt seit Jahren auf hohem Niveau und damit auch die CO2-Emissionen.
- Gas stammt oft aus Ländern, von denen wir uns nicht abhängig machen wollen.
- Die meisten Schweizer Gasversorger gehören der öffentlichen Hand. Damit wären die Bedingungen optimal, um die Gasverteilnetze über die nächsten 15 bis 20 Jahre zurückzubauen und schrittweise aus dem Erdgas auszusteigen.
- Obwohl die Lösungen für den Ausstieg vorhanden sind, passiert kaum etwas. Nun müssen vor allem Städte und Gemeinden – die Besitzer der Gasversorger – entschlossen handeln.
Entschlossenes Handeln bedeutet:
- Gemeinden schreiben den Versorgern in ihrem Besitz einen Ausstiegsplan inklusive Enddatum vor.
- Winterthur und Zürich machen es vor: Dort werden die Gasverteilnetze bis 2040 zurückgebaut. Im Kanton Basel-Stadt sogar schon bis 2037.
- Gemeinden revidieren ihren Energieplan, dies erleichtert den schrittweisen Rückbau der Gasverteilnetze. Der gleichzeitige Auf- und Ausbau von Wärmenetzen hilft dabei.
- Einwohner, Parteien und Verbände machen Druck, wenn die Stadt oder Gemeinde zögert, aktiv zu werden.
Aber Städte und Gemeinden sind nicht allein beim Abschied vom Erdgas. Kantone und Bund sind ebenso gefordert. Sie müssen ...
- kantonale Energiegesetze so anpassen und die MuKEn so aktualisieren, dass der Einbau fossiler Heizungen nur noch in Ausnahmefällen möglich ist. Der Rückbau der Gasnetze gelingt schneller, wenn Hausbesitzer für noch nicht amortisierte Gasheizungen mit dem Zeitwert entschädigt werden. Eine Studie im Auftrag des WWF zeigt, dass der vorzeitige Ersatz von fossilen Heizungen aus Ökobilanzsicht sinnvoll ist.
- Rahmenbedingungen auf Bundesebene so setzen, dass die Produktion von Biogas aus Hofdünger rasch ausgebaut und dieses aus Klimasicht optimal eingesetzt werden kann.
- den Entwurf des Gasversorgungsgesetzes überarbeiten, damit es den Abschied vom Erdgas auf wirtschaft-lich tragbare Art ermöglicht.
Und schliesslich liegt es an allen von uns:
- Am 18. Juni JA stimmen und das Klimaschutzgesetz annehmen. Denn dies erleichtert den Erdgas-Ausstieg: mit zusätzlichen Mitteln für den Ersatz fossiler Heizungen, die energetische Sanierung von Gebäuden und die Entwicklung von Technologien, um industrielle Prozesse unabhängig von fossilem Gas zu machen.
Grosse Gewinne durch raschen Gasausstieg
Ein sorgfältig geplanter und rascher Ausstieg aus fossilem Gas hat viele Vorteile, denn er ...
- reduziert geopolitische Abhängigkeiten,
- erhöht die Versorgungssicherheit, weil Importe durch erneuerbare Energie aus dem Inland ersetzt werden,
- hilft der Schweiz, ihren CO2-Ausstoss stark zu senken und ihre Klimaziele zu erreichen.
Das Trugbild von der klimaneutralen Gasversorgung
Doch vom geglückten Ausstieg aus dem Erdgas sind wir noch ein gutes Stück entfernt:
- Aktuell deckt es 15 Prozent des Schweizer Energiebedarfs. Zwei Drittel dieses Gases wärmen Wohnungen und Häuser von Millionen von Schweizerinnen und Schweizern, das dritte Drittel versorgt die Industrie mit Energie für Prozesse.
- 2019 hat Gas sogar Erdöl als wichtigsten Heizenergieträger abgelöst, und der Verbrauch bleibt hoch.
Doch es gibt positive Schritte: zum Beispiel die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), die bei Neubauten und einem Heizungsersatz vorschreiben, dass die Heizenergie teilweise erneuerbar gewonnen wird. Einige Kantone haben gar ein De-facto-Verbot für neue fossile Heizungen beschlossen.
Gute Schritte, doch sie genügen nicht.
Als Besitzer der meisten Gasversorger hätten es Gemeinden und Städte in der Hand, dem Vorbild von Winterthur, Zürich und Basel-Stadt zu folgen und einen intelligent geplanten Rückbau der Gasverteilungsnetze anzuordnen – wie es auch das etablierte Prinzip «Klimavorbild öffentliche Hand» gebietet.
Aber die überwiegende Mehrheit der Gasversorger handelt, als gäbe es keine Klimakrise und kein Schweizer Netto-null-Ziel. Manche haben bis vor kurzem sogar Prämien bezahlt, wenn Hausbesitzer auf eine Gasheizung umgestiegen sind. Viele preisen ihren Kunden Produkte mit 100 Prozent Erdgas mehr oder weniger subtil als günstig und klimafreundlich an (weil Erdgas einen Viertel weniger Emissionen verursache als Heizöl). Ein kürzlich veröffentlichtes Benchmarking von EnergieSchweiz kommt zum Schluss: «Beim Gas fristen die Erneuerbaren ein Schattendasein», Grund dafür seien «schwache strategische Zielsetzungen». Vom gebotenen Rückbau der Netze kann keine Rede sein.
Die Gaswirtschaft bekennt sich zum Netto-null-Ziel 2050 und will es dank Biogas und synthetischen Gasen erreichen. So soll das gelieferte Gas bis 2030 zu 15 Prozent klimaneutral sein, bis 2040 zur Hälfte und zehn Jahre später vollständig. Wie dies funktionieren soll, haben die Gasversorger nicht schlüssig erklärt, die bisherigen Erfahrungen wecken grosse Zweifel.
Mangelware erneuerbare Gase
Knappes Gut Biogas:
Im Jahr 2022 lag der Anteil von Biogas im Schweizer Netz bei knapp acht Prozent – mehr als vier Fünftel davon importiert. Die inländische Produktion steigt nur langsam. Zwar gäbe es ein grösseres Potenzial, doch eine Reihe von Gründen verhindert dessen Realisierung. Mit den sich verschärfenden Klimagesetzen in der EU ist absehbar, dass die europäischen Länder künftig ihr Biogas selbst brauchen werden. Die Schweizer Gaswirtschaft hat diese Schwierigkeiten offenbar erkannt und das ursprüngliche Ziel von 30 Prozent Biogas-Anteil im Jahr 2030 stillschweigend halbiert. Biogas wird ein knappes Gut bleiben, selbst wenn ein Teil des Potenzials künftig ausgeschöpft wird – was dringend geboten ist. Denn es gibt grossen Bedarf für das wertvolle Biogas: in der Industrie oder für die Abdeckung der Spitzenlast in Wärmenetzen.
Knappes Gut synthetische Gase:
Synthetische Gase – Wasserstoff und Methan aus Sonne- und Windkraft – herstellen, und das Problem ist gelöst? Leider nein. Die Produktion dieser Gase ist teuer und verbraucht sehr viel Energie: Um ein Gebäude mit synthetischem Gas zu heizen, braucht es 6- bis 14-mal mehr erneuerbaren Strom, als wenn man dies mit einer Wärmepumpe tut. Darum schreibt das Bundesamt für Energie in einem Thesenpapier, Wasserstoff (H2) solle nur in Ausnahmefällen zum Heizen verwendet werden. Kurz: Synthetische Gase sind wie Biogas zu wertvoll, um profane Raumwärme zu erzeugen. Sie werden gebraucht, wo es keine Alternativen gibt: für den Schiffs- und Flugverkehr, für die Industrie und eventuell für den Schwerlastfernverkehr.
Die Konsequenzen für das bestehende Gasnetz
Die Klimakrise verlangt eine rasche Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung, die Lösungen dafür sind da – die Konsequenz: Das Gasverteilnetz in der Schweiz muss weitgehend zurückgebaut werden. Es mag einzelne Fälle geben, in denen der Einsatz von Biogas sinnvoll ist, zum Beispiel in eng bebauten historischen Ortskernen, die nicht mit Fernwärme erschlossen werden können und wo kein Platz für Wärmepumpen ist. Aber dafür braucht es nur kleine Restnetze. Auch für die Versorgung der Industrie mit Bio- und synthetischen Gasen und Wasserstoff braucht es spezifische Lösungen und kein engmaschiges Netz in der Fläche.
Weil die Bedingungen für die Produktion von Wasserstoff und synthetischen Gasen aus Sonne und Windkraft anderswo günstiger sind als in Europa, zeichnet sich ein globaler Handel ab. Vorbereitungen dafür laufen, zum Beispiel die Planung eines europäischen H2-Pipelinenetzes. Besonders für die Industrie ist es wichtig, dass die Schweiz daran Anschluss erhält. Aber auch dafür wird es das heutige engmaschige Gasnetz nicht mehr brauchen.
Die Erfahrungen jener Gasversorger, die den Rückbau begonnen haben, deuten auf grosse Risiken für zögernde Branchenmitglieder hin. Die Industriellen Werke Basel haben zum Beispiel das Kantonsparlament gewarnt, trotz des Rückbauhorizonts bis 2037 sei mit millionenschweren Abschreibungen auf Gasnetzinstallationen zu rechnen. Jeder Gasversorger, der den Rückbau seines Netzes noch nicht konkret plant, riskiert «stranded investments». Die Zeche werden die Eigentümer bezahlen, also Städte und Gemeinden.
Bewährte Lösungen, um Erdgas zu ersetzen
Es gibt erprobte Technologien, um den Abschied von fossilem Gas zu schaffen. Die wichtigste ist die Wärmepumpe. Sie nutzt erneuerbaren Strom und kostenlose Wärme aus Boden oder Luft effizient, um unsere Häuser warmzuhalten. Ebenfalls einen Teil leisten Wärmenetze, die das grosse Potenzial an Abwärme aus der Industrie, an Wärme aus Gewässern, Biomasse und Tiefengeothermie nutzen. Solarthermie und in kleinerem Umfang Holzheizungen tragen auch etwas bei. Eine zunehmend bessere Isolation von Neubauten und die Sanierung von bestehenden Gebäuden senkt den Energieverbrauch und entlastet die Stromnetze.
Seit über zehn Jahren nimmt der Anteil Heizungen in der Schweiz zu, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden. 2021 lag ihr Anteil in Neubauten bei über 90 Prozent, beim Heizungsersatz in Altbauten bei fast 60 Prozent. Dies zeigt: Solche Heizsysteme funktionieren und sie behaupten sich auf dem Markt – ihre Einsatzquote muss deshalb bei 100 Prozent liegen. Auch Wärmenetze haben sich bewährt, folgerichtig haben viele Gemeinden ihre Netze ausgebaut, viele weitere Projekte sind geplant.
Für Prozesse in der Industrie, die höhere Temperaturen brauchen, kommen Biogas, synthetische Brennstoffe, Holz oder Strom zum Einsatz.


Die russische Invasion der Ukraine und der damit verbundene Entscheid Europas, sich unabhängiger von russischem Öl und Gas zu machen, hat uns alle vor eine neue Realität gestellt. Auch wir haben deshalb gemeinsam mit unseren Partnern der Umweltallianz unsere Szenarien nochmals überprüft.
Dabei ist klar geworden, dass wir eine sichere Energieversorgung – die in Einklang mit Klima- und Artenschutz steht – nur erreichen können, wenn wir schneller handeln, als bisher geplant war. Bislang hat sich die Schweiz das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die neue Realität zeigt uns, dass es mehr Tempo braucht. Dafür nötig ist ein schnellerer Ausstieg aus fossilen Energien. Dieser Ausstieg ist unerlässlich für den Klimaschutz und macht uns gleichzeitig schneller unabhängig von Importen und reduziert die nuklearen Risiken. Dafür muss die erneuerbare Energieproduktion bis 2035 massiv ausgebaut werden, ohne dabei unsere wertvollsten Biodiversitätsgebiete zu opfern. Mit dieser Forderung bestätigen wir die Position, die wir bereits nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima als machbar vorgerechnet und nachdrücklich gefordert haben.
Wie eine Energiewende bis 2035 gelingen kann, zeigen Energie- und Klimaschutzfachleute der Umweltallianz in einem Gesamtkonzept. Dieses berücksichtigt zwei Dinge: die Transformation des Gesamtenergiesystems und spezifische Lösungen zur klimafreundlichen Energieerzeugung. Anhand von acht Faktenblättern zeigen wir unsere Ideen für eine rasche Energiewende auf, die gut fürs Klima ist und die Biodiversität schützt.
Zukunftsfähige Energiequellen: Drei tragende Säulen
Es sind komplexe Aufgaben, die es zu lösen gilt, und es wird vielfältige Technologien und massgeschneiderte Lösungen brauchen. Wichtig ist ein natur- und klimaverträglicher Mix, der sich ergänzt und das Gesamtsystem resilient macht. Wir empfehlen, die bestehende Säule Wasserkraft zu erhalten und umweltverträglich zu gestalten. Wichtig ist zudem, eine gleich starke Säule der Photovoltaik aufzubauen. Und von ebenso grosser Bedeutung ist die Säule der Effizienz – sie wird oft unterschätzt und hat doch ein riesiges Potenzial.
Wasserkraft erhalten
Schon jetzt ist das umwelt- und naturverträglich erschliessbare Potenzial der Wasserkraft hierzulande zu mehr als 95 Prozent ausgeschöpft Über 1300 Wasserkraftwerke produzierten im Jahr 2020 36,8 TWh Strom. Damit stammen etwa 60 Prozent des im Inland erzeugten Stroms aus Wasserkraft. Wenn bestehende Anlagen erneuert, erweitert oder verbessert werden, könnten noch bis zu 2 TWh zusätzliche Winterspeicherenergie gewonnen werden. In Zukunft werden sich mögliche Produktionssteigerungen und die dringend nötigen und gesetzlich verankerten minimalen Umweltanforderungen in Bezug auf Restwasser bis ins Jahr 2050 ungefähr die Waage halten. Die Wasserkraft bleibt als Stütze des Energiesystems zentral, weil sie flexibel und regulierbar ist und für ein stabiles Netz sorgt – sie muss aber naturverträglicher ausgestaltet sein.
Mehr Effizienz erreichen
In der Schweiz nutzen wir die produzierte Energie weder wirkungsvoll noch sparsam. Eine aktuelle Studie des Energy Journals zeigt, dass es die Schweiz in Sachen Effizienz unter 29 Ländern nur auf den vorletzten Platz schafft. Viel Energie wird schlicht verschwendet, weil Gebäude schlecht isoliert sind, Alternativen zu fossil betriebenen Heizungen und Fahrzeugen ungenutzt bleiben, weil Industrie- und Gewerbeunternehmen ihr Energiesparpotenzial nicht kennen oder nutzen oder weil Geräte im Normalbetrieb oder auf Stand-by belassen statt abgestellt werden. Fakt ist: Allein beim täglichen Stromverbrauch könnten Industrie und Privathaushalte ohne Qualitätseinbusse rund ein Drittel des heutigen Stromverbrauchs einsparen. Beim Energieverbrauch insgesamt ist das Potenzial noch grösser. In dem wir den Energiebedarf den optimieren, erreichen wir nicht nur unsere Klimaziele schneller, sondern mindern auch den Ausbaudruck bei den erneuerbaren Energien. Das wiederum kommt der Biodiversität zugute.
Die Kraft der Sonne stärker nutzen
Die Sonnenenergie wird neben der Wasserkraft zur wichtigsten Energiequelle: Wir können bis 2035 mit 30TWh pro Jahr zehn Mal mehr Solarstrom produzieren als heute. Und damit ist das Potenzial der Photovoltaik (PV) in der Schweiz noch nicht erschöpft. Nach Berechnungen des Bundesamts für Energie (BFE) und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) gibt es ein maximales Ausbaupotenzial von rund 82 TWh, das jährlich auf bereits bestehenden Gebäuden und Infrastrukturbauten produziert werden könnte. Das ist mit Abstand das grösste und umweltfreundlichste Ausbaupotenzial an erneuerbaren Energien. Fassadenanlagen
und Solaranlagen auf Infrastrukturen in sonnigeren Höhenlagen ermöglichen es auch, den Anteil der Winterstromproduktion zu erhöhen. Uns ist wichtig, dass bei allen Freiflächenanlagen, ob sie im Mittelland oder in alpinen Hochlagen geplant werden, trotz der bestehenden Dringlichkeit im Zubau der Schutz der Natur nicht ausser Acht gelassen wird. Es ist keine kluge Idee, schützenswerte Biodiversitätsgebiete und die Perlen der Schweizer Natur mit Schnellschüssen zu opfern. Die Klima- und die Biodiversitätskrise sind eng miteinander verbunden und können nur gemeinsam gelöst werden.


Reicht es, auf Freiwilligkeit zu setzen?
Wir nehmen wahr, dass immer mehr Menschen umdenken und bereit sind, klimafreundlich zu handeln. Mit freiwilligen Massnahmen von Einzelpersonen können die Treibhausgasemissionen der Schweiz um bis zu 20 Prozent reduziert werden. Freiwillige Massnahmen sind wichtig und zu begrüssen. Sie allein werden jedoch für die erforderliche Reduktion des CO2-Ausstosses um 100 Prozent nicht ausreichen. Dafür braucht es, in Ergänzung zur Freiwilligkeit, politischen Gestaltungswillen.
«Geben wir der Politik also ein klares Mandat. Machen wir gemeinsam deutlich, dass die Schweiz für den Schutz von Klima und Biodiversität steht. Stehen wir dafür ein, dass das Gesetz zur Energie- und Stromversorgung so revidiert wird, dass wir eine schnelle Energiewende schaffen und dabei die Biodiversität nicht aus den Augen verlieren. Und machen wir deutlich, dass es beim Referendum zur Gletscherinitiative nur eine richtige Entscheidung geben kann. Unsere Position dazu ist klar. Und ihre? »
Wie sicher bleibt die Versorgung?
Die Vorstellung von einem Schweizer Strommix mit einem substanziellen Anteil an Photovoltaik löst bei vielen die Besorgnis aus, dass die wetterabhängige solare Stromproduktion das bislang hohe Niveau der Versorgungssicherheit gefährden könnte. Doch diese Sorge ist unbegründet. Gerade im Winter hat die Schweiz mit der Speicherwasserkraft sehr viel flexible Kapazitäten zur Verfügung, um die Produktion aus Wind- und Solarenergie auszugleichen.
Wie stehen die Umweltverbände zu schnelleren Verfahren?
Das Konzept zur Sicheren Energieversorgung 2035 wurde von den Organisationen der Umweltallianz entwickelt. In diesem Zusammenschluss engagieren sich Pro Natura, Greenpeace, WWF, BirdLife, SES und VCS konstruktiv für Umwelt-, Klima- und Artenschutz. Sie begrüssen es, wenn Verfahren zur Bewilligung von Produktionsanlagen für erneuerbare Energien effizienter ausgestaltet werden. Das beschleunigt den für die Energiewende nötigen Ausbau. Damit dies gelingt, muss frühzeitig abgeklärt werden, ob sich die potenziellen Standorte für Wind, Wasserkraft und Fotovoltaikanlagen mit den Zielen des Biodiversitätsschutzes vereinbaren lassen. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll in erster Linie dort vorangetrieben werden, wo dies rasch, effizient, mit hohen Produktionspotenzialen und gleichzeitig möglichst geringen ökologischen Auswirkungen möglich ist. Die Umweltverbände verstehen sich als Partner auf diesem Weg.
Ältere Ausgaben
Ältere Ausgaben dieser Berichte zur Energiepolitik finden Sie hier als pdfs zum Download:
- Juni 2022: Energieeffizienz – der schlafende Riese der Energiewende
- Feburar 2022: Ohne die Politik kein Solarboom
- Januar 2022: Biodiversitätsschutz und sichere Stromversorgung gehen Hand in Hand
- Dezember 2021: Droht eine Stromlücke in der Schweiz? Wenn ja, was tun?
Was Sie sonst noch tun können
Unterstützen Sie unsere Arbeit für den Klimaschutz als Mitglied. Wie Sie auf individueller Ebene etwas fürs Klima tun können, zeigen wir Ihnen mit unseren 10 besonders wirksamen Klima-Tipps.